"Schwarze Rosen, denn dort wo Hoffnung ist, siegt das Leben" ein Roman von Wienke Ursula Schulenburg
- El Faro Verlag Licht und Wahrheit
- 26. Dez. 2018
- 11 Min. Lesezeit
Lieber Leser!
Heute stellen wir Ihnen in einer weiteren Leseprobe des El Faro Verlages den Roman "Schwarze Rosen" von Wienke Ursula Schulenburg vor!
In diesem Roman wird die Geschichte von Santiago erzählt, der in einfachen Verhältnissen auf einer kleinen Insel, Mitte des letzten Jahrhunderts lebt und der eine Kindheit voller Schrecken erleben musste. Er ist der Zügellosigkeit und Willkür seiner Mutter ausgeliefert, die ihn in ihre seelischen Abgründe zieht.
Er kann nur knapp dem Wahnsinn seines ihn gefangen haltenden Wahnsinn entkommen und begibt sich auf die beschwerliche Suche nach seiner Wahrheit und der Freiheit, nach der er sich so sehr sehnt.

Widmung
Den Menschen gewidmet, die durch die Hölle auf Erden gehen mussten, die, wie so viele von uns, ihrem seelischen Tod ins Auge blickten und dennoch die Kraft fanden, weiter zu leben und weiter zu kämpfen, für sich und ihr Leben.
Es ist denen gewidmet, die in den härtesten Stunden ihres Daseins nicht die Hoffnung verloren, sondern kämpften und vertrauten, wohl wissend, dass dort, wo noch Hoffnung ist, stets das Leben siegt.
Es war einmal auf einem Fleckchen Erde, irgendwo verloren in den Weiten eines Ozeans an einem Ort, der auch genauso gut überall hätte sein können, wenn er nicht so besonders gewesen wäre…
Auf diesem Eiland weit draußen im Meer wurde eines Tages ein kleiner Junge geboren, ein Kind, das die Sonne in seinem Herzen und die Anlagen eines starken, schönen, in sich geraden und aufrechten Menschen in sich trug. Ein Kind, dessen Bestimmung es war, ein König der verlorenen Herzen zu werden. Ein Mensch, der durch die Kraft seiner Seele und Reinheit seiner Gefühle anderen Menschen ein Spiegel der Wahrheit werden sollte, in dem sie sich selbst und ihr Leid erkennen sollten, um an ihm zu wachsen und wieder heil zu werden und so sich selbst und ihrer Bestimmung ein Stück näher zu kommen. Es sollte ein Mensch werden, der durch sein eigenes Leid gezeichnet und geprägt und dessen Überwindung gereift zu einem Beschützter derjenigen wurde, die hilflos und schwach ihrem Schicksal und der Willkür anderer ausgeliefert waren und verloren gewesen wären, wenn er nicht schützend seine Arme um sie gehalten und stets ein waches Auge auf sie gehabt hätte.
Für diese Menschen sollte er eines Tages zu einem Vorbild werden, einem Menschen, der vielen anderen half, ihr Leben und ihre Seele zu retten und sich aus den Verwirrungen und Verstrickungen ihres fremdbestimmten Lebens zu befreien. Ein Mensch, der aus seinem Inneren heraus strahlte und der im Äußeren doch so unscheinbar und bescheiden daher kam, dass man ihn übersehen hätte. Und der sich tief in die Gefühle der Menschen grub, da er ihre verschütteten, verletzten Seelen mit der seinen, die erst starb, um Kraft seines Willens und der unstillbaren Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung wiedergeboren zu werden, berührte und wieder erweckte.
Denn nur der, der dem Tod ins Auge blickte, nur der, der die tiefsten Abgründe seines Lebens durchschritt und einem Phönix aus der Asche gleich sein Schicksal überwindet, wird die Kraft und den Mut haben, den verschütteten Seelen in den Schluchten der Verdammnis die Hand zu reichen, um ihnen heraus zu helfen aus der Hölle ihres Daseins.
Man hatte den Pfarrer nach alter Sitte und auf den dringlichen Wunsch der Mutter zu dem Neugeborenen gerufen, war dies doch ein alter Brauch in ihrer Gemeinde und darüber hinaus die Geburt eines Kindes etwas nicht Alltägliches und bedeutsam genug, um sich den Segen Gottes zu holen. Eilig hatte der Dorfpfarrer seine heiligen Pflichten ruhen gelassen und war hinauf geeilt den langen, beschwerlichen Weg einer holprigen Straße, die sich durch die verlassene, karge Landschaft ihrer Insel wand, vorbei an knorrigen Olivenbäumen, vertrocknetem Gestrüpp und ein paar mühsam angelegten Feldern und Gärten, in denen man der Erde das Nötigste zum Leben abrang. Es war eine karge Landschaft, die geprägt war von den riesigen Vulkanen, die einst ihre Insel geboren hatten und die majestätisch und stolz ihre Krater gen Himmel hoben und zu schlafen schienen, denn seit langer Zeit herrschte Ruhe auf ihrer Insel, der Feuerinsel. Nur die unendlich scheinenden, schwarzen Lavafelder zeugten von einer Zeit, in der die wahren Herrscher der Insel ihre Macht demonstriert und sie unter ihrer feurigen Wut und glühenden Atem begraben hatten.
Es war heiß an diesem Hochsommertag, die Sonne brannte ohne Gnade von dem blauen, wolkenlosen Himmel herab und brachte die schwarzen Steine zum Glühen, die einer zweiten, schwarzen Sonne gleich ihre Hitze zurück strahlten. Der Pfarrer schwitzte unter seiner dunklen Robe und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er war keiner von hier, sondern ein „Fremder“, wie man ihn lange Zeit genannt und damit auch zurückgewiesen hatte, ein Fremder vom weit entfernten Festland, den die Kirche zu ihnen geschickt hatte. Es hatte ihn viel Kraft, Geduld und Zeit gekostet, sich auf dieser Insel und in den Herzen und Gemütern der Insulaner zurecht zu finden, und obwohl sie die gleiche Sprache sprachen und dem gleichen Land angehörten, gingen die Uhren hier anders und bildeten die Insulaner gemeinsam mit den Menschen der Nachbarinseln des Archipels eine eigene, verschworene Gemeinschaft, die nur schwer zu erobern war.
Oft wäre er fast an ihnen verzweifelt und hätte seiner Aufgabe den Rücken gekehrt, wenn er nicht gespürt hätte, dass hier sein Schicksal lag und es Gottes Wille wäre, seinen Dienst an der Menschheit zu verrichten. Hier in der Einsamkeit einer verlassenen Inselwelt, auf diesem Eiland, wo sich der Herzschlag der Erde, ihr Herzblut und ihre Seele mit der Sonne verband, wo ein Stück Land und Leben aus einem Ozean heraus entstanden war; hier wo Tod und Leben so eng beieinander waren, dass sie sich die Hand zu geben schienen, hatte es ihn festgehalten und intuitiv wusste er, dass er nur hier das würde lernen und erleben können, was seine Seele als Impuls und Ausreifung in diesem Leben brauchte.
Selten hatte er eine totere, ödere Landschaft gesehen als auf dieser Insel. Und selten so deutlich und nah den Kampf des Lebens miterleben können, das sich überall auszubreiten und sein Territorium zurück zu gewinnen versuchte. Diese Kraft war es, die auch er in sich trug und die er an den Menschen bewunderte, die noch dort ihre Felder bestellten, wo andere nur kopfschüttelnd aufgegeben hätten. Doch hatte er auch ihre Schattenseiten kennen gelernt; Seiten, die wohl in allen schlummerten und vielleicht hier, wo die Menschen noch mehr auf sich selbst zurück geworfen waren, deutlicher zum Vorschein kamen. Zumindest kam es ihm so vor, gab es hier doch weniger Ablenkung von dem, was die Menschen in ihrem Innersten bewegte, was sie vorwärts trieb und was sie hinderte, was sie über sich selbst hinauswachsen ließ oder sie hinunter zog in die Abgründe ihrer Seele.
Ja, es war eine Gratwanderung zwischen Leben und Tod, dachte er sich, als er die letzte Biegung zu dem alten Gehöft nahm, eine Gratwanderung, die auch ihn mehr als einmal herausgefordert und mit den Schattenseiten seiner selbst konfrontiert hatte. Und wäre nicht sein tief verwurzelter Glaube an Gott und die Gerechtigkeit des Lebens gewesen, vielleicht hätte er sich nicht halten können, hätte seinen geraden Weg verloren und wäre hinab gestürzt in den Schlund der Hölle, der ihm hier näher an den Menschen vorkam als sonst. Quoll nicht hier und da aus den scheinbar verloschenen Kratern der Vulkane noch Rauch und Dampf und Schwefel hervor? Und obwohl er nicht viel von dem Aberglauben der Insulaner hielt, so musste doch auch er zugeben, dass der heiße Atem der Erde nicht viel Gutes verhieß und einem trotz seiner Wärme einen kalten Schauder über den Rücken laufen ließ.
So war er schließlich auf dem alten Hof der Familie Ferrer angekommen, einem Gehöft, das wohl schon seit Menschengedenken hier stand und immer wieder auf- und ausgebaut worden war. Hier lebte Encarnación Dolores mit ihrem Mann Carlos, einem Fischer, und ihren zwei Kindern. Eine typische Insulanerfamilie. Er kannte Encarnación Dolores, seit sie ein kleines Mädchen gewesen war und es war wohl das Schicksal, was diese beiden Menschen sich hier hatte begegnen und ihre beiden Leben miteinander hatte verbinden und verweben lassen. War er doch für sie mehr als nur ein kirchlicher Vater, sondern der stille Wächter ihrer Seele, der sie zwar nicht vor den Unbilden des Lebens hatte schützen, sie aber in ihrem Leid doch zumindest hatte begleiten können. Sie war einer der wenigen Menschen, die ihr Herz für ihn geöffnet hatte, war eine der wenigen, die ihm Zutritt zu ihrer Seele gestattete und an ihr hatte er aufs Bitterste lernen müssen, dass ihm trotz Macht seines Amtes die Hände gebunden waren und seine Hilfe darauf beschränkt blieb, ihr seelische Unterstützung zu geben, sie aber nicht retten zu können. Durch sie war er auf das zurückgeworfen worden, was er war, durch sie hatte er an seinem Glauben gezweifelt, um wiederum tiefer zu ihm zurück zu finden und es war so, als hätte ihm das Leben selbst diesen Menschen geschickt, damit er durch sie die wahre Bestimmung seines Berufes und seines Lebens würde finden können.
Er öffnete die Tür und betrat die kühle Stube, die hinter dicken Steinmauern lag und die Hitze an sich abprallen ließen. Dankbar nahm er ein ihm gereichtes Glas kühlen Wassers an und setzte sich. Einige Fensterläden waren geschlossen und so war es dunkel in diesem großen Raum, der Küche, Esszimmer und Wohnzimmer beherbergte. Es war ein traditionelles Haus, das wohl mehr gesehen haben mochte im Laufe der Jahre und Generationen, die hier gelebt hatten, als er wissen wollte.
Die knarrende Treppe kam die Mutter von Encarnación herunter, im Arm ein Bündel.
„Das ist er, Herr Pfarrer“, richtete sie ihre Worte an ihn, „mit den ersten Sonnenstrahlen hat er das Licht der Welt erblickt.“
Der Pfarrer näherte sich langsam der alten Frau mit dem Kind auf dem Arm. Tief berührt nahm er den kleinen Erdenbürger in den Arm und ihm war, als wäre er dem Göttlichen dieser Welt ein Stück näher als sonst, als würde er Gottes Wirken unmittelbar spüren können, so wie er es auch oft erlebt hatte, wenn er einen Menschen in den Tod begleitet hatte. Lange betrachtete er das zarte Geschöpf und spürte das Wunder des Lebens, das sich hier in diesem Menschen verwirklicht hatte, der, obwohl so klein und hilflos, bereits einen Charakter hatte und eine Seele, die noch rein und unschuldig war und doch schon mit der Geburt in diese Familie besetzt und auf gewisse Weise infiziert worden war durch das, was sie als Aufgabe, Schicksal und Last in ihrem Leben zu tragen und zu überwinden haben würde.
Angesichts dessen, was dieses kleine Wesen in ihm an Gefühlen auslöste, fühlte er sich klein und unwissend vor dem, was die wahren Geheimnisse des Lebens waren. Er spürte, dass er, obwohl er täglich um die Wahrheit kämpfte, ein kleiner, demütiger Schüler war, der wusste, dass dieses sein Leben nicht ausreichen würde, um es in seiner Unendlichkeit begreifen zu können und wenn er nur eine Ahnung von ihm bekäme, er sich schon glücklich würde schätzen dürfen.
„Herr Pfarrer“, hörte er die raue Stimme der alten Frau, „meine Tochter lässt fragen, ob Sie nicht bei der Namensgebung behilflich sein könnten.“
Lange betrachtete er das schlafende Kind in seinen Armen und öffnete sein Herz, so weit er konnte, um zu spüren, was ihm dieses Wesen sagen wollte. Um zu fühlen, wer dieser Mensch war und welcher Name am besten das ausdrücken würde, was er als Essenz und Aufgabe in sich trug.
Behutsam strich er über den von dunklem Flaum bedeckten Kopf und obwohl dieses Wesen kleiner und zerbrechlicher nicht hätte sein können, so ging doch eine Stärke von ihm aus, die ihn erstaunen ließ. Ihm war, als umgäbe diesen Menschen eine Kraft wie ein Magnetfeld und eine Entschlossenheit, sein Leben zu leben und zu meistern, die er selten bei einem Menschen gespürt und wahrgenommen hatte. Santiago, fuhr es ihm plötzlich durch den Kopf, Santiago de Compostela! Ja, auf dem Jakobsweg, dem Pilgerweg zum Grab des heiligen Santiago, hatte er sich so entschlossen und wie von einer Wolke aus Licht und Kraft umgeben gefühlt, als er über Wochen hinweg durch die Hitze eines spanischen Sommers pilgerte und er mit den Zweifeln über seinen Weg in die Zukunft kämpfte. Er erinnerte sich noch genau an jenen Moment, als er nach langem Kampf endlich eine Antwort in sich gefunden hatte und er seine inneren Schatten hatte besiegen können und für einen Moment das tiefe Gefühl von Klarheit und Einsicht hatte, Einsicht in sein Leben und das, was seine tiefere Bestimmung sein würde.
Als hätte der kleine Junge seine Gefühle gespürt, öffnete er plötzlich seine Augen und sah den Pfarrer an. Es war ein wacher, sehender und wissender Blick, wie es ihm vorkam, ein Blick, der ihm direkt in die Seele ging und dem er sich nicht entziehen konnte, traf er ihn doch dort, wo er nur im tiefsten Gebet versenkt hinzuschauen vermochte. Tief ergriffen verharrte der Pfarrer einen Moment. Wen hatte er hier in diesem kleinen Menschen vor sich? Es musste eine alte, reife Seele sein, die ihn hier aus den Augen dieses Säuglings anblickte, eine Seele, die sich noch einmal dazu entschlossen hatte, sich einen Körper aus Fleisch und Blut zu suchen, um, in ihm gefangen, durch die Niederungen des Lebens zu gehen, um sich formen und verwunden zu lassen, um wachsen, reifen und ein Stück vollkommener werden zu können.
Plötzlich fing der kleine Junge an zu schreien. Der Pfarrer zuckte zusammen, als wäre er aus einer anderen Welt zurück in das Hier und Jetzt gerissen worden. Die Alte trat schnell auf ihn zu und nahm ihm das Kind ab.
„Ich werde ihn zu seiner Mutter bringen, Herr Pfarrer.“
Vorsichtig übergab er das kleine Bündel an die alte Frau, die ihn mit erwartungsvollem Blick ansah. „Santiago soll er heißen, sagen Sie das Ihrer Tochter.“ Und als befürchtete er, die Alte könne den Namen vergessen, wiederholte er noch einmal mit Nachdruck: „Santiago, Señora!“
„Wie der Schutzheilige unseres Landes!“, entgegnete diese, drehte sich um und ging die knarrende Treppe hinauf zum Schlafgemach ihrer Tochter.
-
Jahrzehnte waren ins Land gegangen, als auf einem anderen Flecken irgendwo in dieser Welt, auf einer fernen Insel, ähnlich der, auf der Santiago geboren worden war, ein kleines Segelboot antrieb. Sein Mast war gebrochen und das Segel lag in Fetzen über dem Deck und es schien, als ob die Schicksalskräfte das Schiff gepackt und mit ihm gespielt hatten und es samt seiner Besatzung dem Tode geweiht gewesen wäre, wenn nicht die Hand Gottes selbst sich schützend um seinen zerbrechlichen Rumpf gelegt und es sicher gen festen Boden getrieben hätte. Das Ruder war gebrochen, der Diesel für den kleinen Hilfsmotor war auf der langen Fahrt zur Neige gegangen und hatte den Motor verstummen lassen und so waren sie lange, lange Tage ziellos, wie es schien, vor sich hingedümpelt, irgendwo verloren im Nichts der Unendlichkeit eines Ozeans, ohne ein menschliches Zeichen, ohne Funkkontakt mit immer spärlicher werdenden Vorräten und Trinkwasser, das in der Hitze der unbarmherzig glühenden Sonne in seinen Kanistern zu verdunsten schien.
Schon von weitem hatten die Kinder, die lärmend am Strand spielten, das kleine Boot gesehen und waren aufgeregt zum Inselhaufen gelaufen, um dort von dem fremden Boot zu berichten, denn es kam selten vor, dass sich jemand zu ihnen verirrte. Sofort hatte man ein paar kleine Fischerboote klar gemacht und war hinaus gerudert, den Fremden entgegen.
Das Wasser war glasklar in dieser kleinen Bucht, ein weißer Strand lag wie ein weißes Band zwischen dem Wasser und dem Mangrovenwald und ein Himmel so blau, wie Santiago ihn von daheim kannte, überspannte sie wie ein großes Zelt. Das muss das Paradies sein, dachte er, während er sich von der Sonne verbrannt und ausgedörrt mit müden Händen und letzten Kräften an der Reling hoch zog und wie gebannt auf das Fleckchen Erde starrte, das sich vor seinen Augen aus dem Wasser erhob.
Winkend und laut rufend waren einige Männer in kleinen, abenteuerlichen Booten zu ihm hinaus gefahren. Rettung ist in Sicht, dachte er sich, endlich Rettung! Wenig später machten die kleinen Boote längsseits fest und ein paar kräftige Männer kletterten an Bord. Sie redeten in einer Sprache, die der seinen sehr ähnlich klang und obgleich er schwieg, sprach das Bild, das sich ihnen bot, mehr als es tausend Worte vermocht hätten: ein fast völlig zerstörtes Schiff, ein Mann mit ausgemergeltem Körper und verwildertem Bart, sichtlich am Ende seiner Kräfte. Nur zu gut kannte man hier die Tücken der See und wie es aussah, musste dieser Fremde von weit her kommen, wie die Flagge verriet, die sonnengegerbt und vom Wind zerschlissen am Heck seines Schiffes wehte.
Ich habe überlebt, endlich ist Rettung da, waren die letzten Worte, die Santiago durch den Kopf gingen, bevor ihn eine tiefe Ohnmacht umfing und er auf dem Deck zusammen brach. Es fiel aller Druck und alle Angst und Anspannung der letzten Wochen von ihm ab und erst jetzt, wo er sich in sicheren Händen wusste, konnte er sich fallen lassen. Noch bevor er auf die harten Planken aufschlug, hatten ihn zwei kräftige paar Hände gepackt und festgehalten. Viele Stimmen riefen durcheinander, man suchte nach Wasser, um es dem Fremden zu geben und zog und zerrte an ihm, um ihn zurück zu holen. Doch von alledem bekam Santiago nichts mit, zu tief war die Ohnmacht, in die er gefallen war und zu erlösend das Gefühl, diese Odyssee heil überstanden zu haben.

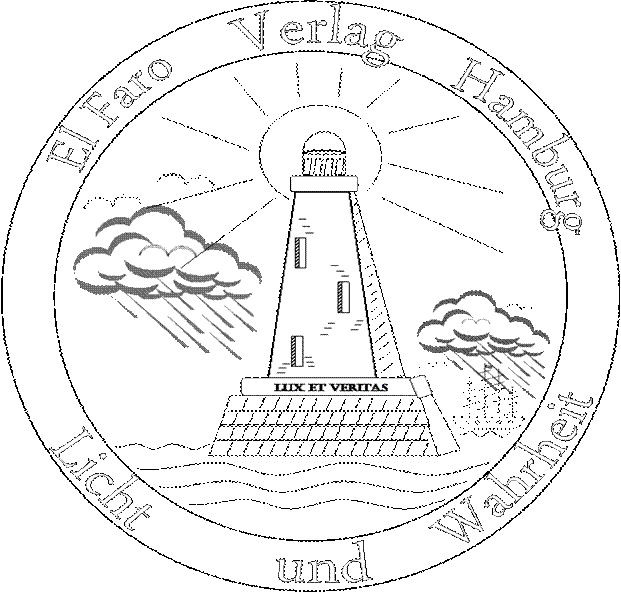



Kommentare